in 2 bis 3 Monaten zu ihrer Solaranlage
Was viele nicht wissen: Die Reform hat direkte Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung von Photovoltaik-Investitionen und könnte die Rentabilität von Solaranlagen deutlich beeinflussen. Der Bundesbeschluss zur Streichung des Eigenmietwerts, über den das Stimmvolk voraussichtlich im Rahmen einer nationalen Abstimmung entscheiden wird, wurde nach intensiver Debatte im Nationalrat und Ständerat verabschiedet.

Die parlamentarische Diskussion zeigte, dass insbesondere die politische Mitte und das Nein-Lager Vorbehalte gegen die Reform haben. Die Vorlage dient als Grundlage für die Abstimmung und markiert einen Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung. Im Zuge der Reform wird auch die Einführung einer Objektsteuer als mögliche Nachfolgeregelung diskutiert. Experten erwarten erhebliche Steuerausfälle für Bund und Kantone, die durch Steuererhöhungen oder andere Massnahmen kompensiert werden könnten. Bau- und Gewerbeverbände warnen vor einem Sanierungs-Stopp, da Sanierungskosten künftig nicht mehr abziehbar wären. Im Gegenzug werden mögliche Steuersenkungen als wirtschaftlicher Impuls ins Feld geführt. Dennoch bleiben viele Fragen zur Reform offen, und insbesondere Mieter haben nichts von der Abschaffung zu erwarten. Alternativ werden unter anderem verschiedene Modelle zur steuerlichen Behandlung von Immobilien und PV-Anlagen diskutiert. Für besitzende Eigentümer bedeutet die Reform, dass Einnahmen aus Vermietung, Zinsen und die steuerliche Belastung für das eigene Haus oder die eigene Immobilie neu bewertet werden müssen.
Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts ändern sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaik-Anlagen fundamental. Die Reform bringt einen Systemwechsel mit sich, der direkte Auswirkungen auf die Besteuerung von Energiemassnahmen hat. Einnahmen aus der Vermietung von PV-Anlagen bleiben jedoch weiterhin steuerpflichtig.
Zentrale Änderungen ab Steuerjahr 2028:
Bundessteuerlicher Abzug für PV-Anlagen entfällt komplett ab Steuerjahr 2028
Kantonale Abzugsmöglichkeiten bleiben bis spätestens 2050 bestehen
Selbstgenutzte Eigenheime mit PV-Anlagen sind von beiden Änderungen betroffen
Steuerliche Mehrbelastung kann bei energetischen Investitionen entstehen
Der Wegfall des Eigenmietwerts bedeutet gleichzeitig das Ende der steuerlichen Abzüge für Unterhaltskosten und Schuldzinsen auf Bundesebene, was insbesondere besitzende Eigentümer betrifft, die bisher Zinsen für ihre Immobilie absetzen konnten. Diese Entwicklungen treffen besonders Wohneigentümer, die in den vergangenen Jahren in nachhaltige Energielösungen investiert haben oder dies noch planen.
Die steuerliche Behandlung von PV-Anlagen kann sich zudem unterscheiden, je nachdem, ob sie sich auf einem Haus oder einer anderem Immobilie befinden.
Die Einführung dieser neuen Regelungen erfolgt schrittweise, wobei der Bund eine Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren nach einer allfälligen Annahme der Vorlage vorsieht. Dies gibt Eigenheimbesitzern Zeit, ihre Investitionsstrategien entsprechend anzupassen.
Bisher konnten Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum ihre PV-Anlage als energetische Sanierung steuerlich geltend machen. Diese Möglichkeit verschwindet mit der Abschaffung des Eigenmietwerts vollständig auf Bundesebene. Zudem sind künftig auch Sanierungskosten, die im Zusammenhang mit der Immobilie oder dem Haus stehen, nicht mehr steuerlich absetzbar.
Konkret betroffen sind folgende Investitionen:
Anschaffung und Installation von Photovoltaik-Anlagen
Batteriespeicher und Wechselrichter
Energetische Sanierungen im Zusammenhang mit PV-Installationen
Dacherneuerungen bei gleichzeitiger PV-Installation
Die steuerlichen Auswirkungen sind erheblich: Bei einer typischen PV-Anlage mit Investitionskosten von CHF 40’000 entfällt künftig eine Steuerersparnis von rund CHF 5’700 auf Bundesebene. Diese Berechnung basiert auf einem durchschnittlichen Steuersatz von etwa 14,3 Prozent, wobei Einnahmen aus der Vermietung von PV-Anlagen weiterhin steuerpflichtig bleiben.
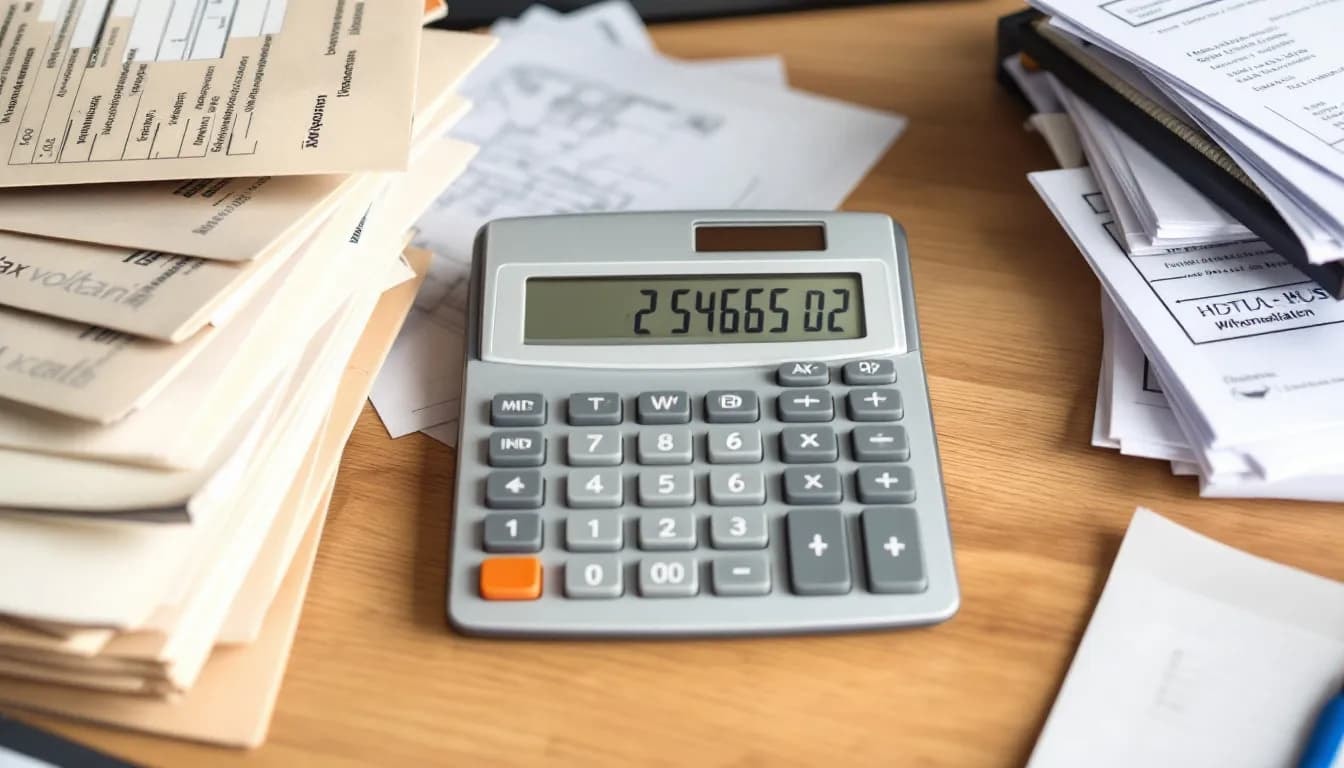
Der Bundesrat begründet diese Massnahme mit der Vereinfachung des Steuersystems. Ohne Eigenmietwert entfällt die Logik, Unterhaltskosten und Investitionen steuerlich zu berücksichtigen. Gleichzeitig können Zinsen für Hypotheken künftig nicht mehr als Abzug geltend gemacht werden, was die Steuerbelastung für viele Besitzende einer Immobilie zusätzlich erhöht. Diese Vereinfachung hat jedoch direkte Konsequenzen für die Energiewende und könnte Anreize für nachhaltige Investitionen reduzieren.
Beispielrechnung für eine CHF 40’000 PV-Anlage:
| Kostenart | Betrag | Steuerersparnis bisher | Steuerersparnis ab 2028 |
|---|---|---|---|
| PV-Anlage inkl. Installation | CHF 40’000 | CHF 5’700 | CHF 0 |
| Jährliche Wartung | CHF 500 | CHF 71 | CHF 0 |
| Total | CHF 40’500 | CHF 5’771 | CHF 0 |
Während der Bund die Steuerabzüge für Energiemassnahmen streicht, können die Kantone freiwillig weiterhin entsprechende Abzugsmöglichkeiten gewähren. Diese kantonalen Regelungen sind jedoch zeitlich auf spätestens 2050 begrenzt.
Im Rahmen des Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung wird in einigen Kantonen die Einführung einer sogenannten Objektsteuer als neue, optionale Steuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen diskutiert, die anstelle der abgeschafften Eigenmietwertsteuer treten könnte.
Die Kantone werden voraussichtlich unterschiedlich auf diese neue Lage reagieren. Einige werden die Förderung erneuerbarer Energien über die Liegenschaftssteuern aufrechterhalten, andere könnten alternative Fördermechanismen entwickeln oder auf kantonale Abzüge verzichten.
Erwartete Entwicklungen in den Kantonen:
Urbane Kantone: Wahrscheinlich Beibehaltung der Energiesparabzüge bis 2050
Ländliche Regionen: Möglicherweise frühere Streichung zugunsten anderer Förderinstrumente
Finanzschwache Kantone: Potenzielle Reduktion der Abzugsmöglichkeiten aus Budgetgründen
Durch die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung ist in vielen Kantonen mit erheblichen Steuerausfällen zu rechnen, die durch andere Massnahmen wie Steuererhöhungen oder neue Abgaben kompensiert werden könnten.
Das Parlament hat bewusst eine Flexibilität für die Kantone vorgesehen, um regionale Unterschiede bei der Energiewende zu berücksichtigen. Diese Lösung trägt dem föderalistischen System der Schweiz Rechnung, schafft aber auch Unsicherheit für Investoren.
Bereits installierte PV-Anlagen sind von der Änderung grundsätzlich nicht rückwirkend betroffen. Die steuerlichen Abzüge, die bereits in Anspruch genommen wurden, bleiben bestehen. Anders verhält es sich bei zukünftigen Erweiterungen oder Neuinstallationen.
Bestehende Anlagen:
Keine rückwirkenden steuerlichen Nachteile
Wartungs- und Reparaturkosten bei vermieteten Liegenschaften bleiben abzugsfähig
Bereits getätigte Abzüge werden nicht rückgängig gemacht
Einnahmen aus der Vermietung von PV-Anlagen bleiben weiterhin steuerpflichtig
Geplante Investitionen:
Installationen ab 2028 ohne Bundesabzug
Kantonale Abzugsmöglichkeiten je nach Region unterschiedlich
Erhöhte Planungsunsicherheit bei langfristigen Projekten
Die Übergangsregelung sieht vor, dass Investitionen, die vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen getätigt werden, noch nach geltendem Recht behandelt werden. Dies schafft einen Anreiz für beschleunigte Umsetzung geplanter PV-Projekte.
Um die konkreten Auswirkungen zu verdeutlichen, betrachten wir ein typisches Beispiel: Ein Ehepaar aus dem Kanton Aargau besitzt ein Haus als Immobilie mit einem Eigenmietwert von CHF 30’000 und Schuldzinsen von CHF 24’000. Die dargestellten Auswirkungen gelten beispielhaft für dieses Haus, sind aber auch auf andere Immobilientypen und besitzende Eigentümer übertragbar, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Aspekte wie Zinsen, Sanierungskosten und weitere Einnahmen. Sie planen die Installation einer PV-Anlage für CHF 40’000.
Bisherige steuerliche Situation:
| Position | Betrag | Steuereffekt |
|---|---|---|
| Eigenmietwert (Einkommen) | CHF 30’000 | + CHF 4’290 Steuern |
| Schuldzinsenabzug | CHF 24’000 | - CHF 3’432 Steuern |
| PV-Anlage (Abzug) | CHF 40’000 | - CHF 5’700 Steuern |
| Netto-Steuereffekt | - CHF 4’842 |

Die Steuerbelastung dieses Haushalts steigt nach der Reform um CHF 5’700 jährlich, was der entfallenen Steuerersparnis durch den PV-Anlagen-Abzug entspricht. Gleichzeitig entfällt aber auch die steuerliche Belastung durch den Eigenmietwert, was in diesem Fall eine Entlastung von CHF 858 bedeutet (CHF 30’000 - CHF 24’000 = CHF 6’000 × 14,3%).
Das Resultat: Eine Netto-Mehrbelastung von CHF 4’842, die hauptsächlich durch den Wegfall des Energiesparabzugs verursacht wird. Diese Berechnung zeigt, wie sich die Rentabilität von PV-Investitionen durch die Reform verschlechtert.
Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts steht auch der Schuldzinsenabzug für Eigenheimbesitzer in der Schweiz vor einem grundlegenden Wandel. Bisher konnten Schuldzinsen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung von selbstgenutzten Liegenschaften entstanden sind, in vollem Umfang von der Steuer abgezogen werden. Nach der Reform wird diese Möglichkeit jedoch stark eingeschränkt – mit spürbaren Auswirkungen auf die Besteuerung und die Steuerabzüge vieler Eigentümer.
Neu wird der Abzug von Schuldzinsen quotal berechnet. Das bedeutet: Nur noch der Anteil der Schuldzinsen, der auf das unbewegliche Vermögen (wie vermietete Liegenschaften oder Zweitliegenschaften) entfällt, kann steuerlich geltend gemacht werden. Wer lediglich ein Eigenheim zur Selbstnutzung besitzt und ansonsten nur bewegliches Vermögen (z.B. Bankguthaben, Wertschriften) hält, verliert künftig das Recht auf den Schuldzinsenabzug vollständig. Diese Anpassung betrifft einen grossen Teil der Eigenheimbesitzer und führt in vielen Fällen zu einer höheren Steuerbelastung.
Eine wichtige Ausnahme bildet der sogenannte Ersterwerber-Abzug. Wer erstmals Wohneigentum erwirbt, kann während zehn Jahren einen begrenzten Abzug von Schuldzinsen geltend machen. Für Ehepaare liegt dieser Ersterwerber-Abzug bei maximal 10’000 Franken pro Jahr, für Alleinstehende bei 5’000 Franken. Der Betrag reduziert sich jährlich um 10 Prozent, sodass der Anreiz für den Erwerb von Wohneigentum in den ersten Jahren nach dem Kauf besonders hoch bleibt.
Diese neuen Regelungen zur Besteuerung und zum Abzug von Schuldzinsen sind Teil des umfassenden Systemwechsels im Rahmen der Abschaffung des Eigenmietwerts. Sie machen es für viele Eigenheimbesitzer notwendig, ihre individuelle Vermögens- und Finanzierungsstruktur zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Gerade bei geplanten Investitionen in Liegenschaften oder bei der Finanzierung von Sanierungen und PV-Anlagen lohnt sich eine frühzeitige steuerliche Beratung, um die Auswirkungen der Reform optimal zu steuern und mögliche Nachteile zu minimieren.
Die Abschaffung des Eigenmietwerts bringt somit nicht nur Veränderungen bei den Steuerabzügen für energetische Massnahmen, sondern auch beim Schuldzinsenabzug – ein Aspekt, der für die langfristige Planung von Eigenheimbesitzern in der Schweiz von zentraler Bedeutung ist.
Eigenheimbesitzer, die eine PV-Anlage planen, sollten die verbleibende Zeit bis zur Umsetzung der Reform strategisch nutzen. Die Übergangsfrist bietet noch Möglichkeiten, von den aktuellen steuerlichen Vorteilen zu profitieren.
Konkrete Handlungsempfehlungen:
Zeitplanung optimieren: Geplante PV-Installationen vor 2028 realisieren
Kantonale Regelungen prüfen: Abklärung der regionalen Förderbedingungen nach 2028
Finanzierung überdenken: Alternative Finanzierungsmodelle evaluieren
Gesamtsanierung planen: Energetische Massnahmen bündeln für maximalen Abzug
Viele Fragen zur optimalen Vorgehensweise, insbesondere im Hinblick auf individuelle Situationen und steuerliche Aspekte, bleiben offen – eine persönliche Beratung ist daher empfehlenswert.
Die Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren gibt ausreichend Zeit für die Planung und Umsetzung von PV-Projekten. Dabei sollten Eigenheimbesitzer nicht nur die Bundesebene, sondern auch kantonale Entwicklungen im Blick behalten.
Mit dem Wegfall der Schuldzinsenabzüge verliert auch die Fremdfinanzierung von PV-Anlagen ihre steuerlichen Vorteile. Zinsen, die bisher als abzugsfähige Kosten bei der Finanzierung einer Immobilie oder eines Hauses galten, können nun nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden. Dies erfordert eine Neubewertung der Finanzierungsstrategien.
Neue Finanzierungsüberlegungen:
Eigenkapital vs. Fremdkapital: Ohne Schuldzinsenabzug wird Eigenkapital attraktiver
Leasingmodelle: Prüfung alternativer Finanzierungsformen
Contracting-Lösungen: Externe Betreiber könnten interessanter werden
Förderbeiträge: Verstärkte Nutzung direkter Subventionen von Bund und Kantonen
Die veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen machen es notwendig, Investitionsentscheidungen primär auf Basis der tatsächlichen Energiekosteneinsparungen und weniger auf steuerlichen Vorteilen zu treffen.
Die Abschaffung des Eigenmietwerts verändert die Wirtschaftlichkeitsrechnung für PV-Anlagen erheblich. Ohne die steuerlichen Abzüge verlängert sich die Amortisationszeit von Solaranlagen um durchschnittlich 2-3 Jahre. Neben PV-Anlagen gibt es unter anderem alternative Investitionsmöglichkeiten im Bereich erneuerbarer Energien, wie beispielsweise Windkraft oder Wärmepumpen, die ebenfalls hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und steuerlicher Rahmenbedingungen geprüft werden sollten.
Veränderte Wirtschaftlichkeit:
| Faktor | Vor Reform | Nach Reform | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Amortisationszeit | 8-12 Jahre | 10-15 Jahre | +2-3 Jahre |
| Jährliche Rendite | 6-8% | 4-6% | -2 Prozentpunkte |
| Steuerliche Ersparnis | 14,3% der Investition | 0% (Bund) | Komplett entfallend |
Die Rentabilität von PV-Anlagen hängt künftig stärker von den tatsächlichen Stromkosten, der Einspeisevergütung und dem Eigenverbrauchsanteil ab. Dies führt zu einer Fokussierung auf technische Optimierung und Energieeffizienz.
Neue Schwerpunkte bei PV-Investitionen:
Eigenverbrauchsoptimierung: Maximierung des selbst genutzten Solarstroms
Batteriespeicher: Investition in Speichertechnologien wird wichtiger
Energiemanagement: Intelligente Steuerung des Stromverbrauchs
Anlagengröße: Optimierung der Dimensionierung für den tatsächlichen Bedarf

Die Energiewende bleibt auch ohne steuerliche Anreize wirtschaftlich sinnvoll, erfordert aber eine genauere Planung und längere Investitionshorizonte. Der Fokus verschiebt sich von steueroptimierter zu betriebswirtschaftlich optimierter Energiegewinnung.
Die verbleibende Zeit bis zur Umsetzung der Reform sollte gezielt für strategische Entscheidungen genutzt werden. Je nach individueller Lage sind unterschiedliche Massnahmen sinnvoll.
Sofortige Schritte für bestehende PV-Anlagen-Besitzer:
Bestandsaufnahme: Dokumentation der aktuellen Anlage und bereits getätigten Abzüge
Erweiterungsplanung: Prüfung möglicher Anlagenerweiterungen vor 2028
Wartungsoptimierung: Sicherstellung der langfristigen Leistungsfähigkeit
Kantonale Abklärungen: Information über regionale Bestimmungen nach 2028
Für Planer zukünftiger PV-Installationen:
Zeitplan erstellen: Umsetzung bis Steuerjahr 2027 prüfen
Offerten einholen: Frühzeitige Kontaktaufnahme mit Installateuren
Finanzierung klären: Optimale Finanzierungsstruktur unter neuen Bedingungen
Gesamtkonzept entwickeln: Integration in umfassende Energiestrategie
Allgemeine Empfehlungen:
Fachberatung einholen: Konsultation von Steuerberatern und Energieexperten
Förderlandschaft beobachten: Verfolgung kantonaler und kommunaler Entwicklungen
Technologietrends verfolgen: Information über neue PV- und Speichertechnologien
Vernetzung suchen: Austausch mit anderen Anlagenbetreibern und Fachverbänden
Für Mieter ändert sich durch die Abschaffung des Eigenmietwerts nichts – sie profitieren von dieser Reform nicht.
Die Abschaffung des Eigenmietwerts markiert das Ende einer Ära steuerlich begünstigter Energieinvestitionen. Gleichzeitig eröffnet sie Chancen für eine marktgetriebenere und technologieorientierte Energiewende. PV-Anlagen-Besitzer, die frühzeitig strategisch planen, können auch unter den neuen Bedingungen von ihrer Investition in erneuerbare Energien profitieren.
Der Schluss ist klar: Wer eine PV-Anlage plant, sollte die verbleibende Zeit bis 2028 nutzen. Wer bereits eine Anlage besitzt, kann beruhigt sein – die Investition bleibt auch ohne steuerliche Privilegien eine sinnvolle Entscheidung für Umwelt und Geldbeutel.
Autorin: Karin M.
Zuletzt aktualisiert: 30.09.2025